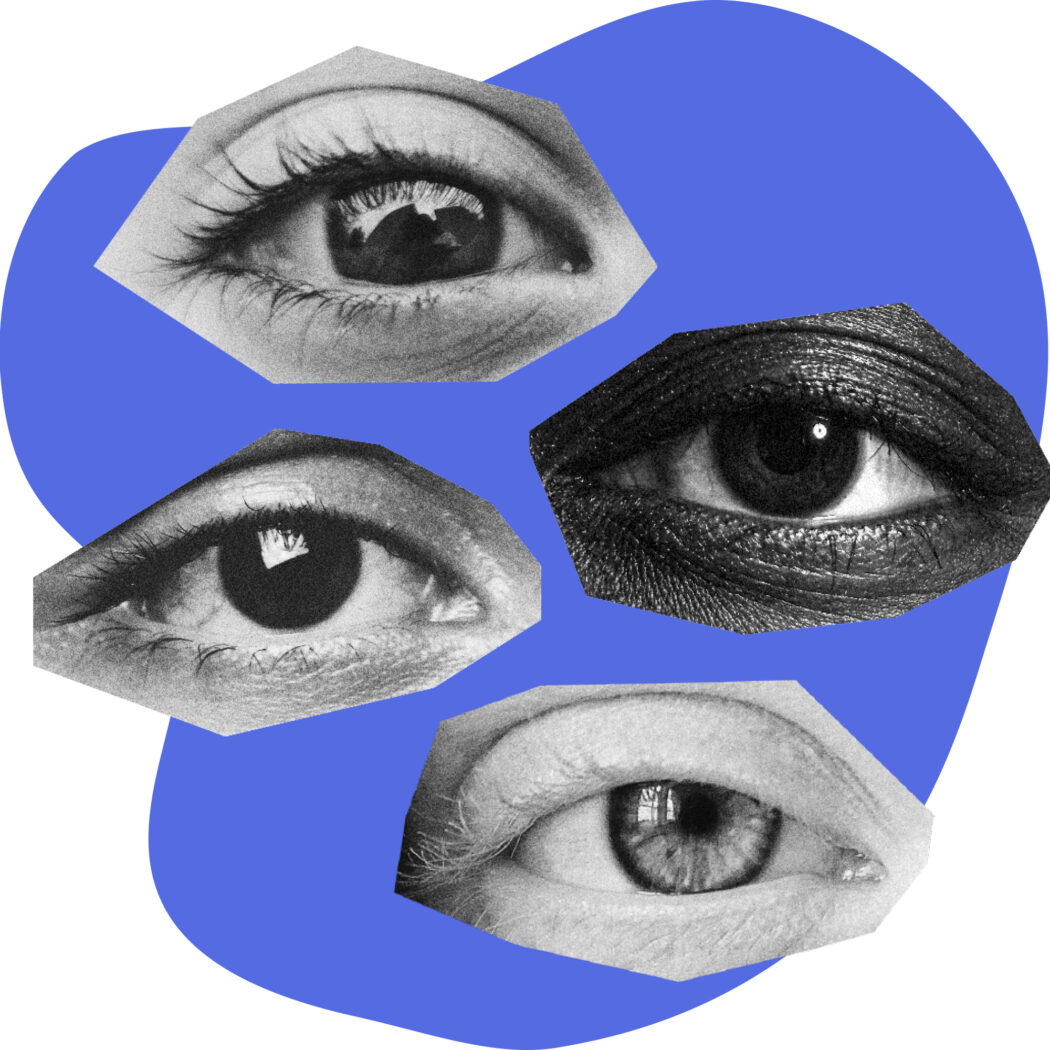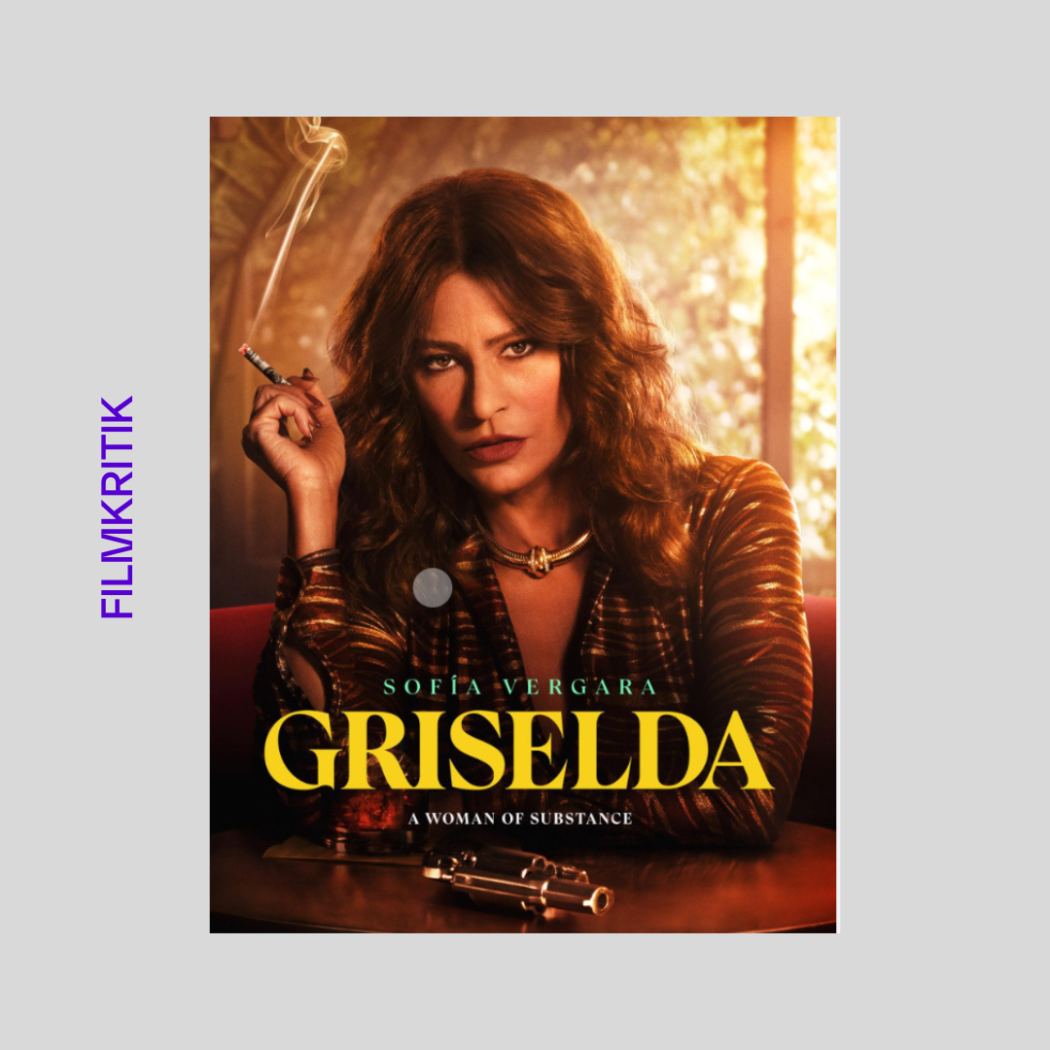Was uns hierhin brachte, bringt uns nicht mehr weiter. Dieser Meinung ist Rosa Grau, und zwar im Bezug auf die Ausweitung und Sicherung der Rechte von trans Menschen. Während die trans Frau mit diesem Pseudonym in der WOZ tiefe Dankbarkeit für die Kämpfe von trans Menschen älterer Generationen ausdrückt, plädiert sie dennoch für einen Strategiewechsel.
Denn das lange verwendete «born this way» Argument, also das Beteuern, man habe schon als junges Kind Körperdysphorie erlebt, sich also vereinfacht gesagt «im falschen Körper gefühlt», war zwar wichtig im politischen Kampf von trans Personen. Diese Vorstellung löst aber gleichzeitig einen unglaublichen Druck aus auf Menschen, die sich ihrer Transidentität gewahr werden. Wenn andere bereits ab dem dritten Lebensjahr mit Sicherheit gewusst haben, dass sie nicht dem Geschlecht entsprechen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, ist es dann überhaupt möglich, dass einem in den Zwanzigern Zweifel daran kommen?
Die andere Seite von «born this way»
Das «born this way» Argument ist im Mainstream angekommen. Während lange die Ungläubigkeit bzw. komplette Ablehnung von Transidentitäten vorgeherrscht hat, lautet die neue Mehrheitsmeinung: «Ok, ich glaube dir, dass du trans bist - aber nur, wenn du dir 100% sicher bist, dass es schon immer so war und auf ewig so bleibt!». Diesen Schluss zumindest legt der SRF Impact Beitrag nahe, der das Thema Detransition behandelt. Tatsächlich gibt es einige Menschen, die sich im Laufe einer Transition dazu entscheiden, wieder in ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zu leben. Längst nicht alle sehen darin aber ein Problem. Sie sind, wie es Anna Rosenwasser in ihrer Republik-Kolumne auf den Punkt gebracht hat, «eine Minderheit einer Minderheit einer Minderheit». Einzelfälle müssen in transkritischen Medienberichten aktuell sehr oft für deren Argumente hinhalten.
Fluidität gilt ein ganzes Leben lang
Zurück zu Rosa Grau. Denn sie geht entspannter durchs Leben, seit sie die Vorstellung aufgegeben hat, wissen zu müssen, was in fünf oder zehn Jahren kommt: «Es reicht mir, wenn ich einen Plan habe, was morgen ist. Bis jetzt war das: eine Frau zu sein. Aber wenn ich in zehn Jahren merke, dass ich mich irre, ist das auch okay. Ich wäre dann ein ziemlich interessanter Vierzigjähriger, der viel über Geschlechter, Rollen und deren Auswirkungen zu erzählen hätte». Das ist doch keine schlechte Vorstellung - wenn nur alle rundherum das auch so entspannt sehen würden. In dem Sinne sind auch (cis) Menschen, die grundsätzlich okay mit ihrem Geschlecht sind, dazu eingeladen, Fluidität zu umarmen. Sie tun dies zumindest zaghaft auch immer zahlreicher, wie die farbigen Fingernägel vieler junger Männer zeigen - oder die Popularität von Kim de l’Horizon.
Doch was meint der Begriff Fluidität eigentlich genau? Er erweitert das traditionelle Geschlechter- bzw. Genderverständnis um zwei Aspekte. Der erste wurde schon behandelt: Gender muss nicht für alle Ewigkeit statisch bleiben. Zweitens erlaubt Fluidität Zwischentöne, für die es im binären System keinen Platz hat. Um es mit einem Farbbeispiel zu illustrieren: Die Existenz von Pink oder Violett verhindert nicht, dass Menschen sich mit den Primärfarben Rot oder Blau identifizieren können. Warum wehrt sich dann eine laute Mehrheit gegen diese Ausweitung des Möglichkeitsraums? Weil sie altbekannte, vielleicht individuell auch bevorteilende, Strukturen in Frage stellt sowie die Instrumente, mit denen wir uns in der Welt orientieren. Wandel und Komplexität sind anstrengend und verunsichernd, Gewohnheiten und Einfachheit angenehm.
Wo wollen wir hin?
Deshalb wird der gesellschaftliche Wandel hin zu einer fluideren Welt auch so bald nicht abgeschlossen sein. Wenn wir gedanklich trotzdem einmal «vorspulen», bleibt die Frage nach dem Danach: Wenn sich unsere Köpfe von der cis-Binarität verabschiedet haben, wird Gender weiterhin identitätsstiftend sein? Oder fällt dieser vielleicht prägendste Identitätsmarker dann komplett weg? Auch in letzterem Fall würde man das Gegenüber wohl mental weiterhin in «Schubladen» einordnen, abhängig davon, wie man es wahrnimmt. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese neuen Marker sich einfacher selbst beeinflussen lassen als das gelesene Gender, etwa indem man dieses Bandshirt anzieht oder jenes Hobby pflegt.